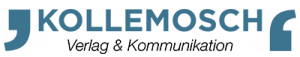„Lesen Sie das mal“, forderte mich vor vielen Jahren mein Deutschlehrer Herr T. auf, ein Sonett vorzulesen. „Sie können das wenigstens richtig!“ Eitel und geschmeichelt von diesem Kompliment schlug ich mein Buch auf und begann, dem Leistungskurs Deutsch die Verse „Alles ist eitel“ des Barockdichters Andreas Gryphius vorzulesen.
Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden.
Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein;
Wo jetzund Städte stehn, wird eine Wiese sein,
Auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden;
…
Momente wie diesen gab es öfter in dem Kurs. Und ich war nicht undankbar darüber. Zum Einen genoss ich solche Zeichen der Anerkennung, von denen es in meiner Schulzeit wahrlich nicht viele gab. Jahrelang war ich verglichen mit meinen Mitschülern eher am unteren Ende des Notenspiegels. Zum Anderen war die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach noch einmal aufgerufen wurde, sehr gering. Meine mündliche Beteiligung war für diese Stunde erledigt, sofern ich mich danach nicht aktiv zu Wort meldete. Der albernen Frage „Was will uns der Dichter damit sagen?“ musste ich mich nicht stellen.
Ok. Geschenkt. Ganz so blöde wurde in den 80er Jahren die Frage nicht mehr formuliert. Trotzdem war die Intention letztlich die Gleiche: Inhalt, Interpretation, Sinn…
Was bei Barockdichtung, für die ich damals ein gewisses Interesse entwickelte, durchaus ein weites Feld ist. Vanitas, vanitatum vanitas ist eben nicht die Antwort auf alles. Auch heute nicht.

In der Oberstufe entdeckte ich die deutsche Lyrik. Maßgeblichen Anteil daran hatte nicht nur der Leistungskurs Deutsch, dem ich aber die „Hauptschuld“ in die Schuhe schieben möchte. Eine Teilschuld trägt sicherlich meine Großmutter, die meinem Bruder und mir schon früh Gedichte rezitierte. Und eine weitere Teilschuld verorte ich bei Lutz Görner und Achim Reichel, die mich noch in meiner Schulzeit lehrten, dass man Gedichte so oder so vortragen kann. Runtergerattert, gestottert und gestammelt – oder gelesen, geliebt, gelebt, gespielt und gesungen.
Darüber schrieb ich bereits in diesem Blog bereits. Vor allem Reichels Album Regenballade war für mich ein Paradebeispiel, Texte von Goethe bis Fontane, von Liliencorn bis Seidel aus ihrer Verstaubtheit herauszuholen und ihnen ungeahntes Leben einzuhauchen. So etwas muss man mögen, sonst kann man damit wenig anfangen.
Der Nebeneffekt, den ich schon damals zu Schulzeiten bemerkte: Völlig automatisch lernte ich so die Texte auswendig – ganz ohne Zwang, ganz ohne schulischen Druck, dass irgendwer mir gesagt hätte: „Bis nächste Woche muss jeder von Ihnen ein Gedicht auswendig können.“
Und ich entdeckte den Spaß daran, Texte laut zu lesen, vorzutragen.
Die Gelegenheit dazu ergibt sich dann und wann, meist sind es allerdings eigene Texte – Geschichten aus meinen Büchern. So ist das eben im #writerslife.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemanden mit einer Ballade eines deutschen Klassikers konfrontiert habe. Ich weiß auch nicht, ob das noch zeitgemäß ist oder ob man sich nicht heutzutage eher mit anderen verwegenen Mitstreitern auf die Bühne stellt und seinem Publikum einen eigenen Text entgegenschleudert. Wie bei einem Slam eben…

Also?
Ich hatte Anfang April die Ehre und das Vergnügen eine Tagung in Wuppertal zu moderieren, nachdem ich dort in den Vorjahren als Referent schlaue Dinge von mir geben durfte: Fünf Vorträge anzumoderieren, die Referenten (alles Männer, wie leider viel zu oft) vorzustellen, nützliche Hinweise zum Tagungsablauf zu geben usw. – und ganz wichtig: Das Programm aufzulockern. Also den Hanswurst zu geben. Oder den Conferencier. Ich entschied mich für Letzteres.
Fünf Moderationen, jede etwa acht bis zehn Minuten lang (was verdammt viel Zeit ist). Das ist harte Arbeit für jemanden, der zwar meint, so etwas zu können aber auch einen sehr hohen Anspruch an sich selbst hat, bevor er für die Tagungsbesucher in eine solche Rolle schlüpft. Was hieß: Texte schreiben, Texte polieren, Formulierungen schärfen, Pointen einbauen. Und das Ganze möglichst frei präsentieren.
So eitel bin ich dann doch.


Was wiederum bedeutet: Alles ausdrucken, auf einen alten Notenständer legen und dann die heimische Bücherwand anspielen. Wieder und wieder. Damit ich meine Texte gut kenne und nichts vergesse, mich nicht verhasple und entspannt über schwierig auszusprechende Namen/Wörter komme ohne zu „stolpern“. Langsam sprechen, laut sprechen, richtig betonen, nicht zu wenig und nicht zu viel.
Atmen an den richtigen Stellen nicht vergessen; beim schnellen, suchenden Blick auf das Manuskript immer sofort wissen, wo ich bin und wo ich noch hin will.
Und immer die Frage: Wohin mit den Händen, was ist zu viel an Gestik? Wann ist es zu wenig?
Bloß nicht die Hände in die Taschen, die Arme nicht vor der Brust verschränken, nicht ans Gesicht fassen, Finger nicht in die Haare vergraben, nicht rumhampeln, den Raum nutzen, das Publikum ansehen, vor allem, wenn ich es anspreche. In der Theorie ist das alles bekannt, in der Praxis ein hartes Stück Arbeit.
Aber gute Vorbereitung ist eben mehr als die halbe Miete – und ein Zeichen des Respekts vor den Zuhörern.
Und beim Üben kommt mir plötzlich in den Sinn, dass es nicht viele Momente gibt, in denen ich mir wünsche, noch einmal Schüler zu sein. Aber wenn, dann wünschte ich mir, noch einmal im Deutsch LK zu sitzen und von Herrn T. aufgefordert zu werden, bis zu kommenden Woche eine Ballade meiner Wahl auswendig zu lernen und frei vorzutragen. Sich vor die Mitschüler hinstellen und „Nis Randers“ von Otto Ernst oder eben besagte „Regenballade“ zum Besten zu geben. Und sich dabei die immer größer werdenden Augen des Lehrers T. anzusehen, der es nicht fassen kann, wie jemand auf solche ausgefallenen Gedichte überhaupt kommt, so eines auswählt, auswendig lernt und dann mehr oder weniger im Sprechgesang „performt“. Und vermutlich wäre meine Rezitation Reichels Liedversionen ziemlich nah.
Hach, wäre das schön. Und eitel.